Inhaltslos durch den Wirtschaftsunterricht?
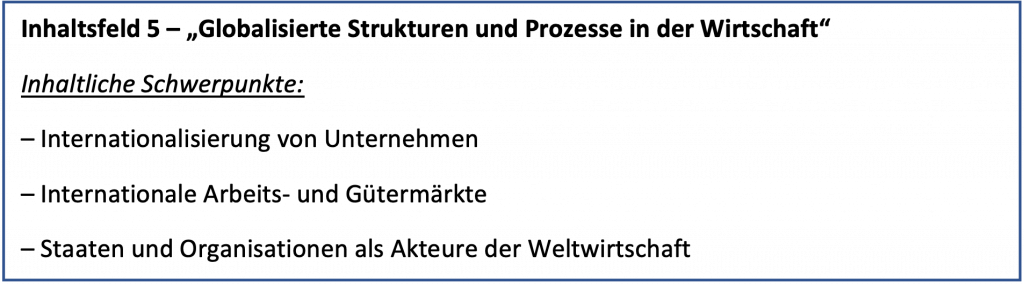
Inhaltsfeld 5 wird üblicherweise irgendwann am Ende der Mittelstufe der Realschule, also in Jahrgangsstufe 9 oder 10 unterrichtet – auch wenn es übrigens vom Ministerium nicht zwingend vorgesehen ist, dass Inhaltsfelder in Unterrichtsreihen umgesetzt werden, ist dies in der Praxis gang und gäbe. Also bleiben wir hier dabei, da die Inhaltsfelder in den Schulbüchern meistens als Kapitel abgebildet sind. Im Gymnasium findet sich ein ähnliches Inhaltsfeld an dieser Stelle. Konkrete fachliche Konzepte und Theorien wie absolute und komparative Kostenvorteile, harte und weiche Standortfaktoren, Konzernstrukturen, Wechselkursrisiken, Zölle, konkrete Handelsabkommen oder nur deren Nennung, Terms of trade, usw. sucht man vergebens. Ein Blick in die Kompetenzerwartungen hilft auch nicht weiter: Dort werden die Inhalte von oben nur mit Verben plus Analysekriterien und Urteilsaspekten verziert. Immerhin sind diese Kompetenzerwartungen implizit mit kleinen Hinweisen auf weitere Inhalte garniert („Freihandel und Protektionismus“). Viel mehr bekomme ich in einem kompetenzorientierten Kernlehrplan durch das Schulministerium nicht vorgegeben, was inhaltlich im Fach los sein soll. Lehrkräfte aus anderen Bundesländern oder dem beruflichen Schulwesen staunen hier: Gibt es in NRW keine Zeitrichtwerte für die Inhaltsfelder? Nein, das entscheiden die Schulen selbst, und damit am Ende die einzelne Lehrkraft. Wenn ich es kurz machen will, bin ich mit Inhaltsfeld 5 nach drei Stunden durch. Wenn ich will, kann ich es auch in 20 Unterrichtsstunden auswalzen – und diese möglichen Schwerpunktsetzungen sind vom Ministerium auch so gewollt. Man kann das gut finden („Hurra, ich kann kreativ sein!“) oder schlecht („Hurra, Ich muss nicht viel können!“).
Die wissenschaftliche Diskussion dahinter ist: Der Kompetenzorientierung wird vor allem aus der Klafki-geschulten Ecke bisweilen vorgeworfen, dass sie nicht zum Bildungsziel der Schule beitrüge, weil sie den Unterricht auf isolierte, in standardisierten Tests abprüfbare Kompetenzen verenge. In die 1980er Jahre jedoch möchte auch niemand zurück, als die Lehrpläne vor allem aus Inhaltssammlungen bestanden, die im Unterricht – wie auch immer! – zu „behandeln“ waren. Reine Inhalte sind weitgehend out – aber warum eigentlich? Denn man kann die Kompetenzorientierung auch von den Inhalten her kritisieren, da die Kompetenzorientierung den „Blick auf den Selbstwert der Bildungsinhalte verstellt und sie zum bloßen Material des Problemlösens“ degradiere (Wiechmann 2013, 27).
Viel zitiert und angeblich symptomatisch ist aus dieser Sicht das Beispiel aus dem Biologieunterricht von Klein (2010), der unvorbereiteten Neuntklässler/innen am Gymnasium kompetenzorientierte Abiturprüfungen vorlegte – mit vollem Erfolg für die Neuntklässler/innen, die mehrheitlich das Bio-Abitur bestanden hätten, ohne freilich jemals die gymnasiale Oberstufe besucht zu haben. Das Geheimnis ihres Erfolges lag in den Abituraufgaben, da „alle zur Beantwortung der gestellten Fragen notwendigen Informationen im umfangreichen Begleitmaterial enthalten sind, in den meisten Fällen sogar die kompletten Antworten entsprechend dem genau formulierten Erwartungshorizont. Im Gegensatz zu den Abiturprüfungen vor dem [kompetenzorientierten, MR] Zentralabitur reicht für die neue kompetenzorientierte Aufgabenstellung Lesekompetenz aus, um die Aufgabenstellung bearbeiten und lösen zu können. Ein grundlegendes biologisches Fachwissen braucht der Schüler nicht einzubringen.“ (Klein 2010, 15)
Ein ähnliches, drastisches Beispiel kommt aus dem ZÖBIS. Der Kollege, ein abgeordneter Lehrer, der die Vorbereitungsseminare für das Praxissemester gab (Master-Phase!), fragte jedes Semester nach den unabdingbaren Voraussetzungen für guten Sowi-Unterricht. Die einhellige Meinung war stets die nach einer soliden Fachkenntnis. Es folgte ein kleiner Test: Der Kollege projizierte Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten an die Wand, die jeweils farblich markiert sind. Die Studierenden mussten bei jeder Frage eine von vier farbigen Karten hochhalten. Der Kollege fragte beispielsweise nach der Definition des Nachfrageüberhangs im Modell der vollständigen Konkurrenz, nach der Definition einer Fraktion des Deutschen Bundestages und welche Parteien seinerzeit die NRW-Landesregierung stellten – Allgemeinwissen also. Trotz, dass die gleichen Studierenden zehn Minuten zuvor Fachwissen als höchst relevant angegeben hatten, waren die Ergebnisse ernüchternd: Sie lagen in allen acht Durchläufen immer nahe oder unter der Ratewahrscheinlichkeit von 25%. Ganz offensichtlich sind diese Studierenden durch das (kompetenzorientierte) Abitur gekommen, ohne Sachwissen darüber, was eine Fraktion und ein Nachfrageüberhang ist – und nebenbei: offenbar haben sie es in der Uni auch nicht gelernt, den Schuh müssen wir uns anziehen! Die Kompetenzorientierung hat also scheinbar zu einer Entwertung von basalem Faktenwissen geführt, wie mein Kollege behauptet.
Schauen wir genauer in unser Fach: Die Ökonomik, wie viele andere Disziplinen auch, kommt ohne bestimmte Erkenntnisgegenstände – Inhalte also – nicht aus. Das ist traditionell die realweltliche Ökonomie und dort relevante Phänomene (z.B. Unternehmen, Haushalte, Regierungen, Zentralbanken mit Phänomenen wie Wachstum, Inflation, usw.). Seit den 1970er Jahren kommen auch gesellschaftliche Phänomen (Heirat, Bildung, etc.) dazu. Damit hat die Disziplin quasi wieder zu ihren Wurzeln zurückgefunden. Hinzu kommen im Fach Definitionswissen über fachliche Konzepte und Anwendungskönnen in Sachen fachlicher Methoden der Bearbeitung, Beurteilung und Bewertung von Sachverhalten. So betont auch Reusser (2014), dass innerhalb der Kompetenzorientierung unabhängig von den Fächern „die kulturelle Dimension von Wissen und fachlicher Bildung zentral“ bleibe. Fachwissen bildet also auch in der Kompetenzorientierung die Grundlage. Da es in Sachen Fachwissen in Bezug auf Definitionen (AFB-I) und die Anwendung von Verfahren (AFB-II) ein Richtig und Falsch gibt, formuliert Helmke: „Fachliche Korrektheit ist nicht alles, aber ohne fachliche Richtigkeit und Genauigkeit ist alles andere nichts.“ (Helmke 2021, 199)
Dies verdeutlicht, dass die Probleme der Kompetenzorientierung aus meiner Sicht Probleme der konkreten Umsetzung sind und weniger des Ansatzes selbst. Dass die Kernlehrpläne – auch in Wirtschaft-Politik (Sek. I) und Sozialwissenschaften (Sek. II) in NRW und vielen anderen Bundesländern – wie oben gesehen weitgehend frei von Inhalten sind (vor allem frei von konkreten fachlichen Konzepten und Theorien, Bayern ist in dieser Hinsicht eine Ausnahme) und das Fach meiner Meinung nach unter anderem deswegen so häufig wie kein anderes fachfremd unterrichtet wird, ist das Problem einer langjährigen Fachkultur. Diese führt ganz offensichtlich ein Eigenleben, losgelöst zumindest von dem Ankerfach Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten (siehe Willkommen in der Echokammer von vorgestern und unsere Schulbuchstudie von 2024)
Positiv gewendet: Das Fachwissen innerhalb der kompetenzorientierten Kernlehrpläne könnte man deutlich stärken und in die mittlerweile weitgehend entkernten stichwortartigen Inhaltslisten der Inhaltsfelder deutlich mehr Fleisch ans Skelett packen, vor allem auch, weil der Kernlehrplan Sozialwissenschaften aus meiner Sicht mittlerweile vollkommen veraltet ist, sich verselbständigt hat und sich offensichtlich nur noch durch seine eigene Tradition legitimiert – nach dem Motto: „Das haben wir schon immer so gemacht!“ (siehe dazu ebenfalls den Blogbeitrag von Juli 2025: Willkommen in der Echokammer von vorgestern). Dazu gehört eben auch, fachliche Methoden, Konzepte und Theorien in den Kernlehrpläne festzuschreiben, statt nur ein paar inhaltliche Stichpunkte, die im Zweifel auch mit einem politikwissenschaftlich inspirierten Unterricht abgehandelt werden können, um damit zweierlei zu signalisieren: Die Ökonomik als ein universitäres Ankerfach für Sowi ist nicht optional, und: Sowi ist damit kein leichtes Zweitfach (Schuhen et al. 2013). Wenn man das Fach ernst nimmt, ist es eines der anspruchsvollsten.
Autor:
Marco Rehm, ZÖBIS, November 2025
rehm@wid.wiwi.uni-siegen.de
Literatur
Goldschmidt, Nils; Kron, Romina; Rehm, Marco (2024): Marktwirtschaft und Unternehmertum in Schulbüchern. Potsdam und Berlin. (https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/1693)
Helmke, Andreas (2021): Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Hannover.
Jahnke, Thomas; Klein, Hans Peter (2012): Die Folgen der Kompetenzorientierung im Fach Mathematik, Journal für Didaktik der Biowissenschaften, Nr. 2, S. 1-9.
Klein, Hans Peter (2010): Die neue Kompetenzorientierung: Exzellenz oder Nivellierung, Zeitschrift für Didaktik der Biowissenschaften, Nr. 1, 2010, S. 15-26.
Reusser, Kurt (2014): Kompetenzorientierung als Leitbegriff der Didaktik. In: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Bd. 32, Nr. 3, S. 325-339.
Schuhen, Michael; Schürkmann, Susanne; Kibedi von Varga, Karen (2013): Lehramt Sozialwissenschaften – Warum wählen Studierende dieses Fach? In: Zeitschrift für ökonomische Bildung, Nr. 2, 2013, S. 1-16.
Wiechmann, Ralf (2013): Kompetenzorientierung – Wirklichkeitsverlust als Prinzip von Bildung. In: Mathematikinformation, Nr. 60, S. 27-37.